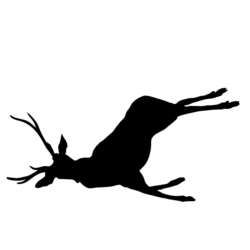Im Neuköllner Rathaus arbeitete bis 1933 eine jüdische Ärztin: Käte Frankenthal (*1889, Kiel – †1976, New York). Sie war einer der ersten Frauen, die in Deutschland das Staatsexamen in Medizin ablegte. Politisch engagierte sie sich ab der zweiten Hälfte ihres Studiums in der SPD. Sie gehörte zum linken Flügel der Partei und war zwischenzeitlich Bezirksabgeordnete sowie Landtagsabgeordnete. 1918 bis 1924 arbeitete sie als (Assistenz-) Ärztin in der Berliner Charité. Daneben betrieb sie eine eigene Praxis, die sie auch nutzte, um Ehe- und Sexualberatungen durchzuführen und in der sie als überzeugte Gegnerin des Paragrafen §218 kostenlos Verhütungsmittel verteilte.
1928 zog sie als Stadtärztin (etwa vergleichbar mit dem Gesundheitsamt) ins Rathaus Neukölln ein und war dort auch für die Eheberatungsstellen zuständig. Als Abgeordnete der SPD in der Stadtverordnetenversammlung stellte sie einen Antrag, in dem sie forderte, sexuelle Aufklärung und Ausgabe von Verhütungsmitteln als öffentlicher Dienst in den städtischen Eheberatungsstellen zu etablieren, dem 1930 stattgegeben wurde. 1931 trat sie in die Sozialistische Partei Deutschlands (SAP) ein, da sie die Tolerierungspolitik der SPD gegenüber der NSDAP kritisierte. Nach der Machtübertragung an Adolf Hitler und die NSDAP am 30. Januar 1933 waren sie sowie ihre Genoss_innen von der ersten Verfolgungswelle der Nationalsozialist_innen betroffen. Auch ihr Vorgesetzter, der kommunistische Stadtrat Richard Schmincke, war in dieser ersten Welle festgenommen worden. So avancierte Frankenthal automatisch zur Stellvertretung des Stadtrats. Als solche hatte sie Zugang zu dessen Dienstzimmer, in dem sich einige kommunistische Parteiakten mit Namen und Adressen befanden. Frankenthal konnte diese erfolgreich aus dem Büro des Stadtrats schmuggeln und vernichten. Die Beseitigung und Vernichtung von Akten wurde mit einer Gefängnisstrafe bestraft. Durch diese Aktion konnte sie einigen Genoss_innen die Gefangennahme oder Lageraufenthalte ersparen.
Bereits im März 1933 emigrierte Frankenthal nach Prag. Sie befürchtete, zu stark mit dem Antrag von 1930 über die umfunktionierung der Eheberatungsstellen assoziiert zu werden. Ihr Name war in der Berliner Politiklandschaft bekannt. Zudem war sie sich bewusst, dass sie als Jüdin, Sozialistin und Intellektuelle der Verfolgung der Nazis ausgesetzt gewesen wäre. Die Eheberatung wurde schließlich 1934 zur „Rassen- und Eheberatungsstelle“ umgewandelt. Seit dem Inkrafttreten des Zwangssterilisationsparagraphen wurde hier unter anderem darüber entschieden, wer wen unter welchen Umständen heiraten durfte.

Am heutigen Sonntag jährt sich die Befreiung des Bezirks
Neukölln durch die Rote Armee zum 74. mal. Dies haben wir zum Anlass
genommen, um euch hier bis zum Tag der Befreiung am 28. April täglich
einen historischen Ort in Neukölln vorzustellen. Es sind Orte von
jüdischem Leben, Verfolgung und Widerstand.
Dabei vergessen wir nicht, dass Antisemitismus, Rassismus und Neonazismus Teil des bundesdeutschen Alltags sind.
Unser Dank heißt auch weiterhin Krieg den deutschen Zuständen!